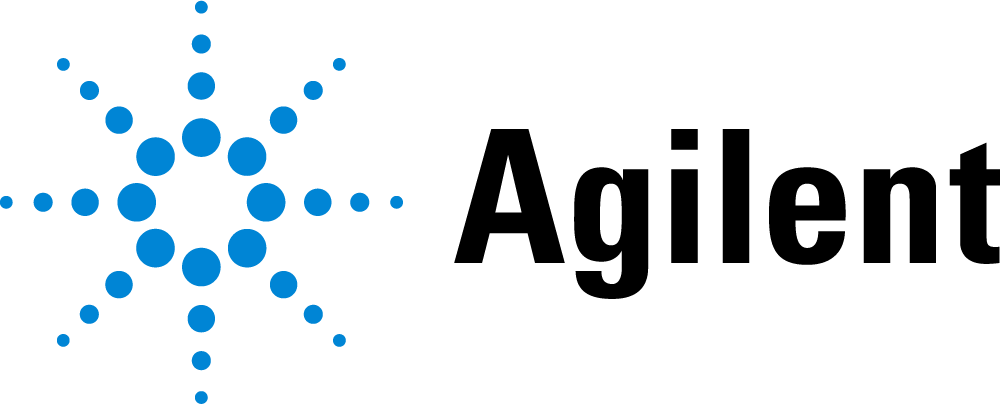DIE FÖHR-STORY
Der Name Föhr wurde teilweise abgeleitet von dem Wort „feer”, was so viel wie Friesisch oder Grün bedeutet. Heute geht man davon aus, dass sich der Name von „fahren” ableitet, ein Ort, zu dem man „hinfährt”.
Auf Föhr wird von etwa 2.000 Einwohnern, insbesondere der Dörfer im Westen der Insel, eine Variante des Friesischen gesprochen. Diese Sprache wird nach der Insel als Fering bezeichnet. Ein Fering ist ein Ureinwohner der nordfriesischen Insel Föhr.
Von Föhr ging ein bedeutender Walfang aus. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die holländischen und englischen Grönlandfahrer meistens mit Inselfriesen bemannt. Bekanntester Walfänger war seinerzeit der „Glückliche Matthias“. Sein Nachfahre Dr. med. Matthias Matthiesen ist einer der Mitbegründer von Sünjhaid!. Ende des 18. Jahrhunderts lebten rd. 1000 Seefahrer, darunter 150 Schiffsführer auf der Insel. Auch die dänische Krone und die Freie und Hansestadt Hamburg profitierten von den Föhrer Kapitänen. Die Sloman Reederei, Hamburgs älteste Reederei, bevorzugte z.B. Föhrer Kapitäne, deren prominentester Vertreter der Kapitän Paul Nickels Paulsen war, dessen Nachfahr Dr. med. Frederik Paulsen 1950 FERRING Pharmaceuticals und 1988 die Ferring-Stiftung – www.ferring-stiftung.net – in Alkersum auf Föhr gründete. Sein Sohn Frederik übernahm die philathropische Tradition und eröffnete 2009 zu seinem 100-sten Geburtstag das Museum Kunst der Westküste: www.mkdw.de
Die Qualifikation der Navigation gab den Ferings einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, daran knüpft „RÜNJHAID! Freundeskreis der nordfriesischen Seefahrerinseln Föhr und Amrum e.V.“ an. Da sich somit die Wurzeln von RÜNJHAID! auf die traditionellen Föhrer Naviagationsschulen gründen, beschränken wir uns in dieser Darstellung auf deren Geschichte:
Die Föhrer Navigationsschulen
Vortrag von Dr. Volkert Faltings am Donnerstag, den 1. Mai 2003 in der Ferring-Stiftung in Alkersum auf Föhr anläßlich der Eröffnung von Sünjhaid!2003:
Vielen von Ihnen erzähle ich kaum etwas Neues – und wenn Sie es bisher nicht wußten, dann ahnten Sie es sicherlich schon längst, daß die Seefahrt auf den nordfriesischen Inseln Föhr, Amrum und Sylt, aber auch auf den unmittelbar benachbarten Halligen einst eine herausragende Rolle spielte, was aufgrund der amphibischen Verhältnisse des Landes im übrigen nicht verwundern dürfte. Das Thema, mit dem ich Sie heute bekanntmachen möchte, lautet die „Föhrer Navigationsschulen – ein nachahmenswertes Modell“. Bevor ich nun mit Ihnen inter medias res gehen werde, lassen Sie mich zuvor eine kurze Rückschau auf die Seefahrtsgeschichte der Inselnordfriesen halten, denn ohne diese Rückschau scheint mir das Thema kaum verständlich.
Archäologische Funde lassen vermuten, daß die Inselnordfriesen schon bei ihrer Einwanderung im 7./8. Jh. in das Gebiet der heutigen Nordfriesischen Inseln, des sogenannten Utlands, Seefahrer oder besser – ähnlich den Wikingern – seefahrende Bauern waren mit einem großen Aktionsradius entlang der Nordseeküste. Feste Handelsrouten führten sie weit nach Norden an die damaligen skandinavischen Handelsplätze, in den Süden bis zur Rheinmündung und von dort nach England. Daran änderte sich wohl auch im Hoch- und Spätmittelalter nur wenig, obwohl wir darüber kaum etwas wissen. De facto sind nur einzelne, meist hanseatische Quellen überliefert, in denen die Nordfriesen als Kauffahrer, z.T. aber auch als Kaperer auftreten, doch ist diese Sicht der Dinge – zumindest mit Blick auf das Letztere – am Ende etwas einseitig, denn in den Auseinandersetzungen der Hanse mit der dänischen Krone kaperten zeitweise auch die Hanseaten, speziell die Hamburger, was sie kriegen konnten. Der Böse ist erfahrungsgemäß immer der andere.
Gesichertere Nachrichten gewinnen wir erst im 14./15. Jahrhundert, als uns die Inselnordfriesen als Heringsfischer bei Helgoland wiederbegegnen. Zusammen mit Niederländern, Hamburgern, Jüten und anderen Nordseeanrainern stellen sie den unermeßlichen Heringsschwärmen nach, die sich zu jener Zeit in der südlichen Nordsee um Helgoland alljährlich ansammelten. Die Nachfrage nach diesem „Gold des Meeres“, wie der Hering gelegentlich bezeichnet wurde, war schier unerschöpflich. Das zur Konservierung der Heringe benötigte Salz kochten die Nordfriesen aus dem Seetorf unter den seewärts gelegenen Salzwiesen. Nordfriesische Kauffahrer transportierten nicht nur das Salz, sondern auch die eingesalzenen Heringe in ihren Schmacken bis an den Rhein oder nach Südnorwegen. Sowohl die nordfriesischen Fischer als auch die Salzsieder und Kauffahrer gelangten dabei zu Wohlstand. Damit war es jedoch Mitte des 16. Jahrhunderts jäh zu Ende, als die Heringsschwärme in den Fanggründen vor Helgoland aus bis heute nicht geklärter Ursache plötzlich ausblieben – wobei Überfischung, wie wir sie heute leider immer wieder erleben, in damaliger Zeit nicht die Ursache gewesen sein kann. Infolgedessen ging es mit der Wirtschaft hierzulande bald steil bergab. Plötzlich konnte Nordfriesland seine Kinder nicht mehr ernähren.
Ein Ausweg aus dieser offenbar naturgegebenen Wirtschaftskrise sollte sich freilich bald einstellen. Englische, vor allem aber niederländische Entdecker, die am Ende des 16. Jahrhunderts auf der Suche nach einer damals noch für möglich gehaltenen Nordpassage nach Ostasien die Arktis erkundeten, berichteten von massenhaften Walvorkommen in den Gewässern um Grönland und Spitzbergen, so daß nach 1611 unter den damaligen seefahrenden Nationen ein regelrechter Run auf das größte Säugetier der Welt, den Wal, einsetzte. Englische, holländische, dänische, dann auch spanische und hanseatische Fangschiffe jagten fortan in immer größerer Anzahl dem Gold der Arktis, dem Waltran, nach. Dieser Rohstoff avancierte innerhalb kurzer Zeit zum Leuchtstoff der Zukunft, mit dem etwa schon bald die Straßenlaternen in Hamburg, London, Amsterdam oder Paris befeuert wurden. Später gaben auch die Barten der Wale, das sogenannte Fischbein, gute Erträge. Als Spezialisten des Walfangs galten von altersher die Basken und so verwundert es nicht, daß die niederländischen Walfangkompanien baskische Harpuniere und Speckschneider in ihren Schiffsmannschaften bevorzugten. Nordfriesische Seefahrer dürften in dieser Anfangsphase eine nur untergeordnete Rolle in den niedrigeren Chargen der Walfänger-Hierarchie gespielt haben.
Mit dem Rohstoff Tran, dem begehrten Leuchtstoff, der so viel heller und nachhaltiger brannte als das bis dahin gebräuchliche Rüböl, konnten innerhalb weniger Jahre immense Vermögen angehäuft werden. Man kann sich daher leicht vorstellen, daß es bei der stetig wachsenden internationalen Konkurrenz nicht lange währte, bis zwischen den walfangenden Kompanien erste Rivalitäten ausbrachen. Die daraus resultierenden politischen Dissonanzen zwischen Frankreich und den Niederländischen Generalstaaten führte dazu, daß die französische Krone ihren baskischen Untertanen bei schwerer Strafe verbot, auf Schiffen ihrer niederländischen Hauptkonkurrenten anzuheuern. Nutznießer dieser Art von Protektionismus, der im übrigen völlig wirkungslos blieb, waren die inselnordfriesischen Seefahrer, die die durch die Basken hinterlassenen Lücken problemlos schließen konnten. Die alten Verbindungen der Inselnorfriesen zu den Holländern, die sich während der gemeinsamen Zeit der Heringfangs vor Helgoland herausgebildet hatte, waren offenbar noch nicht vergessen.
Allerdings haben auch die Niederländer nichts aus diesem Vorgang gelernt: Trotz der schlechten Erfahrungen, die die französische Konkurrenz mit dem Ausreiseverbot für ihre baskischen Seefahrer gemacht hatte, versuchten die Holländer eine Generation später, nämlich 1664, ihre hanseatischen Wettbewerber auf dieselbe Art aus dem Rennen zu werfen: Auch sie untersagten ihren Seefahrern, auf hanseatischen Walfängern anzuheuern. Nutznießer – sie ahnen es bereits – waren wiederum die inselnordfriesischen Walfänger, die sofort in die entstehende Personallücke nachstießen.
In der Regel besetzten die niederländischen Walfangkompanien im 17. Jahrhundert den Posten des Kommandeurs und anderer hoher Schiffsoffiziere mit Landsleuten. Die hanseatischen und manche englischen Reedereien taten dies – möglicherweise mangels geeigneter Kandidaten – nicht. In wachsender Zahl stiegen dort die inselnordfriesischen Walfänger in die Spitze der Mannschaftshierarchie auf, indem hier fast durchgegend ein friesischer Kommandeur, ein friesischer Steuermann oder Harpunier auf den Fangschiffen engagiert wurde. Während der hohen Zeit des Walfangs um 1750 hatte Föhr ca. 5.500 Einwohner, davon allein ca. 1.600 Seefahrer, d.h. fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung befand sich während der Sommermonate zur See, davon allein 150 Schiffsführer, 74 Steuerleute, 150 Harpuniere und 7 Schiffsärzte, d.h. wiederum fast ein Viertel der Föhrer Seefahrer besetzte bei der Ausfahrt eine der so lukrativen Positionen eines Schiffsoffiziers. Wenn man bedenkt, daß in jener Zeit etwa im Schnitt 3.900 Seeleute per anno auf niederländischen Walfängern ausfuhren, wovon ziemlich genau die Hälfte Ausländer sind, von diesen schließlich weit über 90% Inselnordfriesen, dann kann man ermessen, welche enorme ökonomische Bedeutung der Walfang für die damalige insulare Bevölkerung hatte.
Dabei war es nicht unerheblich, ob man sich dem Walfang als einfacher Seemann oder als Kommandeur oder wenigstens doch als Steuermann oder Harpunier, d.h. als Schiffsoffizier, widmete, wie folgender Vergleich zeigt. Demnach verdiente ein Kochsmaat in jenen Jahren bei erfolgreicher Heimkehr pro Saison etwa in heutiger Währung 3.500 Euro, ein Altmatrose immerhin schon 7.000 Euro, ein Walfangkommandeur dagegen 28.000 Euro oder fast viermal so viel. Kein Wunder also, daß jeder, der die Eignung dazu besaß, schon beizeiten danach strebte, in die Hierarchie der Schiffsoffiziere vorzustoßen. Tatsächlich kommt um 1750 auf Föhr auf 30 Walfänger ein Grönlandkommandeur. Das ist im Vergleich zu den niederländischen oder hanseatischen Verhältnissen ein ungewöhnlich – fast unglaublich – hoher Anteil, und man stellt sich die Frage, wie das angehen kann.
Nicht zuletzt friesische Chronisten haben in der Vergangenheit öfter – nicht ohne Stolz – auf diesen Umstand hingewiesen, und insbesondere in den Zeiten der 1.000 Jahre, die ja gottlob nur 12 Jahre dauerten, hat man rassische – heute würde man sagen genetische – Gründe bemüht. Das hohe, harte Friesengewächs, durch ein gefahrvolles, entbehrungsreiches Leben an und mit der See gestählt, sei in einem jahrhundertelangen Selektionsprozeß, in dem sich nur der rassisch Starke durchgesetzt habe, quasi durch seine ihm typische Erbmasse, prädestiniert gewesen, die Führungspositionen im damaligen europäischen Walfang einzunehmen. Die arische Rasse habe sich auch auf diesem Gebiet beispielhaft durchgesetzt.
Das ist natürlich nichts als verquaste Rassenideologie oder mit anderen Worten blanker Unsinn! Die Erklärung ist viel unspektakulärer, wenngleich nicht uninteressanter. Walfang war zu damaliger Zeit ein hartes, schmutziges, von vielerlei Gefahren geprägtes Geschäft, das zudem schlecht bezahlt wurde, wenn man nur ein einfacher Seemann war. Eine kopfstarke Familie konnte er damit mehr schlecht als recht ernähren und in der Tat lebten zahlreiche Familien solcher einfachen Walfänger oft an der Armutsgrenze. Reichtümer waren dagegen im Walfang nur zu erwerben, wenn es gelang, in die Position eines Schiffsoffiziers aufzurücken, am liebsten verständlicherweise in die Stellung eines Kommandeurs, aber das setzte umfangreiche Kenntnisse in Mathematik, Navigation und Astronomie voraus, von seemännischem Geschick einmal ganz abgesehen. Solche Kenntnisse konnte verständlicherweise nur eine gründliche und vor allem fachmännische nautische Ausbildung vermitteln. Zu dieser Einsicht gelangten die Betroffenen schon früh und bereits im 17. Jahrhundert begegnen uns erste Zeugnisse von Navigationsschulen auf Föhr. Navigationsschulen fanden sich bis dahin lediglich in den großen Hafenstädten fern den abseits im nordfriesischen Wattenmeer gelegenen Inseln an der schleswigschen Wesküste. Ein Besuch dieser Schulen wäre für die Mehrzahl der inselnordfriesischen Seefahrern nicht nur aus geographischen, sondern allein schon aus finanziellen Gründen kaum möglich gewesen. Dieses Manko konnte nur durch Hilfe zur Selbsthilfe überwunden werden.
Promotor dieser Selbsthilfe war – für Außenstehende zunächst vielleicht erstaunlich – nicht vom Fach, sondern Pastor an der St. Laurentii-Kirche in Süderende auf Föhr. Die Rede ist von Richardus Petri, der 1597 auf Dagebüll als Sohn des dortigen Pastors geboren wurde und der seit 1620 bis zu seinem Tod 1678 nahezu 6 Jahrzehnte das Amt des Seelsorgers im Kirchspiel St. Laurentii im Westen der Insel Föhr ausübte. Wie es heißt, habe Petrus Richardi schon bald nach seinem Amtsantritt Seefahrer seiner Gemeinde in der Steuermannskunde unterrichtet. Das ist insofern bemerkenswert, als der geistliche Herr selber niemals ein Schiff geführt hat, geschweige denn überhaupt jemals eine längere Seereise unternommen hat. Allerdings kam die Neigung zur Steuermannskunde vielleicht doch nicht von ungefähr. Richardus stammte ja – wie gesagt – von Dagebüll, das damals noch eine uneingedeichte Hallig war und ganz überwiegend von Schiffern bewohnt wurde, die in ihren kleinen Küstenseglern den Schiffshandel entlang der Nordsee zwischen Holland und Südnorwegen betrieben. Unter diesen Schiffern wird der aufgeweckte Pastorensohn schon früh mit nautischen Fragen in Berührung gekommen sein – und wer weiß, vielleicht wäre er selbst gerne Schiffsführer geworden, wenn ihn sein Vater nur gelassen hätte.
Daß Richardus Petri sich auf jeden Fall umfassende Kenntnisse in der Steuermannskunde erworben haben muß, steht außer Frage, und daß er sie den Seefahrern seiner Gemeinde vermittelte, ebenfalls, doch ingesamt gesehen, wissen wir über die ganzen Vorgänge nur wenig. Vermutlich gehörte auch einer der berühmtestesten, zumindest aber erfolgreichste Walfänger seiner Zeit, nämlich der aus Oldsum stammende Matz Peters oder Matthias Petersen, auch der „Glückliche Matthias“ genannt, zu seinen Schülern. Die Organisation von Richardus Petris Navigationsschule kennen wir indes nicht; hier sind wir ebenfalls auf Vermutungen angewiesen. Sicherlich wird der Schulbetrieb lediglich in den Herbst- und Wintermonaten stattgefunden haben, wenn die Seefahrer vom arktischen Walfang wieder in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt waren. Auch ein besonderes Schulgebäude bestand nicht, ja, selbst der Schulbetrieb lief wohl nicht nach festen Regeln ab. Vielmehr trafen sich die Navigationsschüler unterschiedlichen Alters und in wechselnder Zusammensetzung und in einem eher lockeren Rhythmus wohl im Hause des Pastors im Pastorat in Süderende, wo sie zunächst eine gründliche Unterweisung in der Mathematik erhielten. Spätere Navigationsschüler wie der bekannt gewordene Jens Jacob Eschels, dessen Name in die heutige Jens-Jacob-Eschels-Straße in Nieblum eingegagen ist, schreibt in seinen Lebenserinnerungen über das Jahr 1774: „Ich ging diesen Winter in die Steuermannsschule, und zwar abends von 6 – 12 Uhr, denn am Tage hatte der Lehrer Nickels Wögens, welcher in jungen Jahren auch zur See gefahren war und nun das Uhrmacherhandwerk trieb, keine Zeit. Jeder Schüler hatte seine drei Rechensteine [d.s. Schiefertafeln] mit, die mußten alle Abend voll gerechnet sein. Des anderen Tages wurde es dann von den Tafeln in mein Steuermannsbuch geschrieben. Ich rechnete in 35 Abenden die ersten zwei Bücher von Claas Hendriksen Gietermaker durch und bezahlte für jeden Abend einen Schilling lübsch und habe selbe hernach in 25 Tagen noch einmal durchgerechnet für einen Schilling pro Tag, so daß mein Lernen der Navigation mir nur 60 Schillinge oder ein Speciestaler gekostet hat.“ Soweit Jens Jacob Eschels. Man stelle sich das heute einmal vor, man würde einen etwa 16jährigen Schüler damit beauftragen, ein recht umfangreiches mathematisches Aufgaben- und Übungsbuch in 35 Unterrichtsstunden, freiwillig natürlich und abends, zunächst in Kladde durchzurechnen und dann in Schönschrift noch einmal in das Steuermannsbuch zu übertragen. Aber nicht genug damit: Das Ganze möge dann noch einmal in 25 Stunden durchgerechnet werden. Ein Aufschrei würde durch die Reihen der studierten und selbsternannten Pädagogen gehen. Allerdings beherrschten die damaligen Schüler nach solch einer Ochsentour ihr Metier! Und damit kein Mißverständnis entsteht: Es handelte sich dabei um Aufgaben, die man heute wohl kaum einem gymnasialen Schüler im Leistungskurs Mathematik als Abituraufgabe zu stellen wagte. Jede Abiturprüfungskommission würde diese Aufgaben als zu schwer ablehnen müssen, obwohl heute modernste tabellarische Kompendien und vor allem ein Taschenrechner zur Verfügung stehen. Die damaligen Schuler müssen ihren Taschenrechner im Kopf gehabt haben, denn ohne die Fähigkeit, schnell und zuverlässig im Kopf rechnen zu können, hätten sie die oft komplexen Rechenvorgänge der Aufgabenstellungen kaum bewältigen können.
Wie wir sehen, muß es sich bei diesem Unterricht um eine Art Chrashkurs gehandelt haben, den man bei Bedarf in den darauffolgenden Jahren wiederholen und auffrischen konnte. Lehrbücher im heutigen Sinne gab es nur wenige. Hervorzuheben ist allerdings das weit über Holland hinaus bekannt gewordene und schon genannte Werk des Claas Hendriksen Gietermaker, „Schatkamer der Stuurlieden“, das entlang der gesamten Nordseeküste die Grundlage des Navigationsunterrichts bildete und vielerorts als Vorbild für spätere Lehrbücher diente. So schrieb der Föhrer Nanning Arians (föhr. Nahmen Arfsten) 1743 in Anlehnung an Gietermaker das Lehrbuch „Schat-Kammer, Konst der Stuur-Lieden“, das handschriftlich in holländischer Sprache erhalten geblieben ist. Überhaupt kursierten die Lehrbücher selten in gedruckter Fassung, sondern lediglich in Abschriften, die der Schüler sich entweder selbst anlegte oder von einem Vorgänger übernahm. Die Sprache der frühen Lehrbücher ist fast durchgehend niederländisch, denn Niederländisch ist die Sprache der damaligen kontinentalen Seefahrt, wie es beispielsweise Englisch für die heutigen Piloten ist. Der Unterricht selbst fand wahrscheinlich auf Friesisch statt. Deutsch spielte für die damaligen Inselfriesen eine nur untergeordnete Rolle, kam allenfalls in der Kirche als Lutherdeutsch vor und wurde im übrigen von vielen, insbesondere von Frauen und Kindern, auch gar nicht verstanden. Ein anderes von einem Föhrer namens Ocke Tückis verfaßte Lehrbuch mit dem Titel „Besteckbuch“ war noch nach 1800 unter den Föhrer Navigationsschülern in Gebrauch. Nicht zu vergessen sind ferner die Werke die Föhrers Hinrich Braren aus Oldsum, der im 19. Jahrhundert an der von ihm geleiteten Seefahrtsschule in Tönning an der Eider ganze Generationen von Schülern geprägt hat und dessen pädagogisches Geschick in den heute noch bekannten Lehrbüchern gerühmt wird. Auffällig an allen diesen Lehrbüchern ist schließlich, daß sie sehr stark praxisorientiert sind – was man unseren heutigen Lehrbüchern ja oft abspricht (Pisa läßt grüßen) – und vor allem orientierten sie sich an der abschließlichen Steuermannsprüfung. Ganze Prüfungsgespäche werden im Wechsel von Frage und Antwort beispielhaft durchgespielt und dienten wohl ebenfalls dazu, sie sich durch Auswendiglernen zu verinnerlichen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die vielfach geäußerte Ansicht verweisen, daß praktisch jeder Friese ein geborener Rechenmeister sei, der die Rechenkunst als geistiges Erbe quasi mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Diese opinio communis geistert ja unausrottbar durch die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, unter anderem etwa in Storms Novelle „Der Schimmelreiter“, in der Storm die Hauptfigur, den Deichgrafen Hauke Haien, als einen mit Arithmetik und Algebra naturbegabten Friesen hinstellt. Auch einem Klassenkameraden von mir wurde von unserem ehemaligen Französischlehrer einmal beschieden: „Friesen können rechnen, aber sonst gar nichts!“ Sogar die Friesen selbst tragen selbstgefällig und stolz diese Meinung vor sich her, gelegentlich allerdings auch entschuldigend, wie unlängst einmal eine friesische Mutter einer Sextanerin anläßlich eines Elternabends, die auf meine leisen Vorhaltungen, ihre Tochter hätte etwas abstruse Vorstellungen von deutscher Orthographie, schulterzuckend auf friesisch entgegnete: „Wi kön jo bluat reegne!“ Dabei ist die Auffassung, Friesen seien geborene Rechner, natürlich nur ein Topos, ein vielbenutztes Klischee, an das derjenige, der es gebraucht, nur zu gerne glauben will, obwohl die Unsinnigkeit des Klischees längst statistisch erwiesen ist. Eine Untersuchung am hiesigen Gymnasium, in der die Leistungen friesischstämmiger Schüler in Mathematik, Deutsch und Englisch der letzten 30 Jahre mit den entsprechenden Leistungen der übrigen, nichtfriesischen Schüler verglichen wurden, belegte es klar: Die Zensuren der Friesen in Mathematik ragten keineswegs über den Durchschnitt der übrigen Schüler hinaus, im Gegenteil, sie waren sogar geringfügig schlechter. Deutlich besser als ihre nichtfriesischen Schulkameraden waren die Friesen jedoch in Englisch, was mich als Sprachwissenschaftler allerdings nicht überrascht: Hier schlagen die bilingualen Fähigkeiten der Friesen zu Buche. Ein bilinguales Kind ist einem monolingualen – mit Blick auf die sprachliche Mobilität – im Normalfall immer überlegen, was natürlich gerade beim Erwerb einer Fremdsprache von einem enormen Vorteil ist. Die meisten Europäer waren vor der Entwicklung der europäischen Nationalstaaten zwei- oder sogar mehrsprachig und sind erst im Laufe des 19. Jahrhunders durch das nationale Schulprogramm einsprachig gemacht worden, im Falle der Friesen z.T. gewaltsam; rückblickend betrachtet war das natürlich eine unendlich törichte, aus nationaler Verblendung begangene Dummheit, wie so vieles, was der Idee des europäischen Nationalstaats entsprang.
Doch kehren wir zum Navigationsunterricht zurück! Woher kamen dann aber die herausragenden mathematischen Fähigkeiten der inselnordfriesen Seefahrer, die allerorts gerühmt wurden? Meines Erachtens hat sich, bedingt durch die Seefahrt und die damit verbundenen regionalen Navigationsschulen, über mehrere Jahrhunderte erst eine gewisse mathematische Tradition unter den Inselfriesen entwickelt. Mathematik genoß und genießt immer noch im kulturellen Bewußtsein dieser Menschen einen höheren Stellenwert als anderswo. Ich bin sogar bereit zu sagen: Sie ist Teil ihrer friesischen Identität. Mit genetisch bedingter Prägung hat das freilich nichts zu tun!
Der große Zulauf, den diese privat organisierten Föhrer Seefahrtsschulen für sich verbuchen konnten, hatte indes auch einen ganz handfesten Grund: Das Unterrichtsgeld überstieg kaum die laufenden Unkosten für Brennmaterial und Licht, mancher der Navigationslehrer erhob nicht einmal diesen Unkostenbeitrag. Der bereits zitierte Jens Jacob Eschels bezeugt ja, daß ihn sein Unterricht gerade einmal einen Speziestaler per anno gekostet habe, der damals etwa den Gegenwert von 25 kg Roggen ausmacht. oder etwa 8 kg Butter. Das ist in der Tat kein besonders hoher Betrag. Hier schlägt noch der Geist Richardus Petris, des Begründers der Föhrer Navigationsunterrichts, durch, von dem berichtet wird, daß er seinen Unterricht kostenlos durchgeführt habe, allerdings mit der Maßgabe, daß diejenigen, die es später zum Kommandeur oder Steuermann brächten, sich ebenfalls kostenlos um die Weitervermittlung ihrer Navigationskenntnisse an die nachfolgende Jugend bemühen sollten, was dann auch geschah. In beinahe jedem größeren Ort auf Föhr gab es diese privaten Navigationsschulen, manchmal sogar mehrere, die des Winters von erfahrenen Kommandeuren oder anderen Schiffsoffizieren, in ihrer guten Stube abgehalten wurden, nicht selten übrigens auch von den einheimischen Dorfschullehrern, die sich mit dem geringen Schulgeld ihr schmales Lehrerentgelt aufbesserten. Einigen dieser Lehrer ging es nur um die mitgebrachten Brennmaterialien, denn die waren auf Föhr seinerzeit knapp und teuer.
Das Einzugsgebiet der Föhrer Navigationsschulen war beachtlich; es kamen im Winter nämlich nicht nur die Föhrer Seefahrer in den Unterricht, sondern auch die von den benachbarten Inseln Sylt und Amrum, sogar von entfernt liegenden Halligen und den Dörfern des nordfriesischen Festlandes kamen Schüler herbei, die meistens in den Häusern der Lehrer gegen Kost und Logisgeld untergebracht waren. Das zeigt, daß die Föhrer Navigationsschulen unter den nordfriesischen Seefahrern einen hervorragenden Ruf genossen, demzufolge das Ausbildungsniveau dieser Schulen hoch gewesen sein muß. Meines Erachtens war es jedoch das Organisationssystem der privaten Navigationsschulen ausschlaggebend für ihren Erfolg, und das lautete: Hilfe durch Selbsthilfe, durchgeführt von kompetenten Praktikern, die ihre Kenntnisse praxisnah an ihre Schüler weiterreichten, und das alles in einer beinahe privaten familiären Atmosphäre in der guten Stube des Lehrers – und obendrein noch fast kostenlos. Gerade der letzgenannte Umstand ermöglichte es auch minderbemittelten Schülern einen qualifizierten Unterricht zu erhalten, wenn sie nur die geistigen Voraussetzungen dafür mitbrachten. Der Besuch des Navigationsunterrichts war also nicht vom Geldbeutel des Vaters abhängig wie in den staatlichen Seefahrsschulen der großen Hafenstädte. Nur so ist es zu erklären, daß auffällig viele Föhrer Kommandeure aus ärmlichsten Verhältnissen stammen, aber dank ihrer fundierten Ausbildung doch schnell in die angesehene Position eines Walfangkommandeurs oder Handelsschiffskapitäns aufsteigen konnten, darunter im übrigen zwei meiner unmittelbaren Vorfahren, nämlich Dietrich Roeloffs und Früd Faltings, die das ohne den Besuch einer Föhrer Seefahrtsschule allein aus finanziellen Gründen niemals hätten bewerkstelligen können. So erklärt sich ferner schließlich auch der ungewöhnlich hohe Prozentsatz von Schiffsführern und Schiffsoffizieren, den wir bereits im Vorhergehenden beschrieben haben. Daß diese privaten Schulen über eine so lange Zeit funktionieren konnten, daß etwa die Kommandeure als die geistige und ökonomische Elite einer Seefahrergesellschaft sich überhaupt bequemten, sich mit dem – in Anführungsstrichen – „niederen Volk“ abzugeben und nicht unter ihresgleichen blieben, liegt ganz entscheidend an den recht geschlossenen sozialen Strukturen der eingeborenen insularen Bevölkerung, die man bis auf den heutigen Tag als egalitär bezeichnen kann. Der begüterte Kommandeur, manche von ihnen waren nach heutigen Maßstäben Multimillionär, unterschied sich in seinem Äußeren, seinem Habitus und seiner Sprache kaum von einem normalen Matrosen. Man begegnete ihm sicherlich mit Respekt, für gewöhnlich jedoch nicht mit devoter Unterwürfigkeit, und einem einfachen Matrosen – auch einem Schiffsjungen – wäre es nie in den Sinn gekommen, den hohen Herren anders als mit seinem Vornamen anzureden und zu duzen. Noch heute kann man unter den Föhringern keinen größeren Faux pas begehen, als seine materielle oder geistige Überlegenheit „heraushängen zu lassen“, wie man salopp zu sagen pflegt. Schweigendes Nichtbeachten und spöttische Blicke wären die Folge.
Was ist aus den privaten Föhrer Navigationsschulen geworden? Als zu Anfang des 19. Jahrhunderts in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, aber auch im Königreich Dänemark, dem der Westteil der Insel zusammen mit Amrum unterstellt war, eine abgelegte Steuermannsprüfung für eine spätere Kapitänskarriere obligatorisch wurde, hatte das auf diese Schulen keinen Einfluß. Ganz im Gegenteil! Der Besuch des privaten Navigationsunterricht war für viele die unumgängliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Steuermannsexamen an einer staatlichen Seefahrsschule in Altona, Kopenhagen und anderswo. Das änderte sich erst, als eines Tages, genauer, am 19. Juli 1864, die Insel im Zuge des deutsch-dänischen Krieges von österreichischen Truppen besetzt wurden, um uns zu befreien, wie sie behaupteten oder vielleicht sogar wirklich meinten, und in dessen Folge das Herzogtum Schleswig am 12. Januar 1867 von Preußen annektiert wurde. Von da an war es mit den privaten Seefahrtsschulen auf Föhr vorbei. Privater Navigationsunterricht paßte nicht in das staatlich kontrollierte Schulsystem der Preußen und war wohl auch für die verantwortlichen Beamten, die das Verbot der Föhrer Navigationsschulen betrieben, nicht vereinbar mit ihrem damaligen Staatsverständnis, wonach derartige hoheitliche Aufgaben nur vom Staat betrieben und kontrolliert werden dürften. Natürlich steckten auch ganz andere Interessen dahinter. Bereits vor dem Krieg hatte Bismarck über die Ziele dieser sich anbahnenden Auseinandersetzung mit Dänemark im Gespräch mit seinen Militärs unter anderem verlauten lassen, daß es bei einer möglichen Eroberung der Herzogtümer Schleswig und Holstein auch um die Hafenstädte an Nord- und Ostsee und vor allem auch um die dort ansässigen Seemannschaften ginge, ohne die er den Aufbau einer Kriegsflotte für nicht möglich hielt, jedenfalls für nicht so schnell, wie er das plante und erhoffte. Aus diesem Grunde galt es natürlich diese Seemannschaften im staatlichen Griff zu behalten, wobei verständlicherweise die privaten Seefahrsschulen im Wege standen. Allerdings ging für die Preußen der Schuß nach hinten los, indem unter den inselnordfriesischen Seeleuten eine Massenauswanderung in die USA einsetzte, als ruchbar wurde, daß die Preußen eine dreijährige Militärdienstzeit auf den Schiffen Ihrer Majestät, des Königs von Preußen ins Auge gefaßt hatte, was sie um so mehr erbost haben muß, als daß es sie bis dahin unter der dänischen Verwaltung eine Befreiung vom Militärdienst genossen hatten. Diese Landflucht quittierten die neuen Herren mit jahrzehntelangen Repressalien. Seefahrer, die auf das Territorium Preußens zurückkehrten, ohne vorher freiwillig ihren Militärdienst in der Flotte abgeleistet zu haben, wurden, sofern sie noch preußische Staatsbürger waren, inhaftiert, oder wenn sie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hattem, ausgewiesen und mit bleibendem Einreiseverbot belegt. Das hatte zur Folge, daß die Seefahrer, von denen im Prinzip viele rückwanderungswillig waren, ihre Frauen und Bräute in die USA nachholten, wodurch die Auswanderungswelle – anders als von den preußischen Behörden erhofft – nur noch verstärkt wurde. Als die verantwortlichen Stellen ihren elementaren Irrtum endlich begriffen und 1872 in Wyk mit einer staatlichen Seefahrtsschule gegensteuerten, war es zu spät. Das Vertrauen in die neue Staatsführung war nach den voraufgegangenen Erfahrungen verloren gegangen und es wird berichtet, daß den Föhrern zudem der steife offizielle Umgangston in dieser Schule nicht paßte. Das waren sie aus den Kapitänsstuben der privaten Föhrer Seefahrtsschulen anders gewohnt, wo es eher familiär, wenngleich nicht weniger ernst zuging. Der Betrieb der staatlichen Schule wurde bereits nach wenigen Jahren wieder eingestellt.
Kehren wir am Ende meines Referats noch einmal zu Richardus Petri zurück! Selbst wenn über sein Wirken als Navigationslehrer nur wenig bekannt geworden ist, so steht sein Name doch für ein einzigartiges Modell von Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit, die eine ganze Insel und die darauf lebenden Menschen über mehrere Jahrhunderte sowohl kulturell als auch ökonönisch, ja, eigentlich in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, befördert und beflügelt hat, ohne daß sie der Hilfe des Staates bedurft hätten. Leider ist die herausragende Leistung dieses Mannes, deren Tragweite er sich selbst vermutlich gar nicht bewußt war, heute vielfach in Vergessenhat geraten, obwohl dieses Modell gerade in unserer jetzigen Zeit von Nutzen sein könnte, in der verstärkt wieder von Hilfe zur Selbsthilfe und Eigeninitiative die Rede ist. Es hat in der jüngeren Vergangenheit allerdings nicht an Versuchen gefehlt, Richardus Petri vor der angesprochenen Vergessenheit zu bewahren, unter anderem dadurch, daß man angeregt hat, eine Föhrer Schule nach ihm zu benennen, was zweifellos ganz angemessen gewesen wäre, doch scheiterte dieser Vorstoß an der beharrlichen Ignoranz vorgeschalteter Behörden, die in solchen Angelegenheiten mitzureden pflegen. An dieser Ignoranz wird sich nach meiner jahrzehntelangen Erfahrungen mit solchen Instanzen auch nichts ändern, denn – um ein Bibelzitat leicht abzuwandeln – „die behördliche Ignoranz währet ewiglich!“
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Volkert Faltings